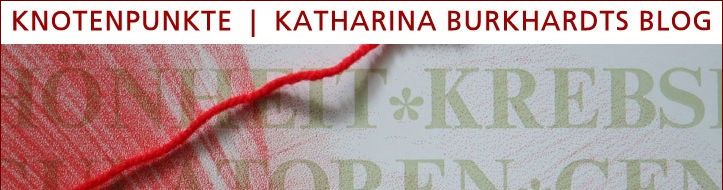All die kleinen Augenblicke
Dieser Text ist für meine Mutter, die diese Woche 70 wird und das Internet wie viele Errungenschaften des 20. Jahrhunderts als unglaublich ärgerliche Zeitverschwendung empfindet.
Bisweilen erschreckt mich mein eigenes Mitteilungsbedürfnis. Wie komme ich dazu, Ihnen (ja, Sie da, die Sie eigentlich nur wissen wollten, wie man in zwei Monaten einen Krimi schreibt, und sich dann festgelesen haben – herzlich willkommen in unserem kleinen virtuellen Büro!) und Ihnen, der Sie regelmäßig mal vorbeischauen, weil Sie den Praktikanten süß finden, Details aus meinem wenig spektakulären Privat- und Berufsleben anvertrauen zu wollen? Bilde ich mir allen Ernstes ein, Sie interessiert, was ich von Kaizen, Atomkraft, geschweige denn vom Web 2.0 halte, was mir auf der Pasta-Party oder beim Lauftraining durch den Kopf geht und ob ich mich von der Schweinegrippen-Panik anstecken lasse?
Was in einem Blog noch verbrämt als mehr oder weniger tiefgründige Betrachtungen über den Alltag des durchschnittlichen Internet-Nutzers im beginnenden 21. Jahrhundert daherkommt, darf sich bei Twitter hemmungslos austoben: der Impuls, die Mit- oder gar die Nachwelt an jenen Momenten teilhaben zu lassen, deren flüchtige Banalität uns, während wir sie erleben, in ihrer unerträglichen Bedeutungsfülle schier das Herz zerlegt.
Tweets sind die primitivste Form jener uralten Tradition, dem Leben – dieser unaufhaltsamen, unvorhersehbaren Bewegung auf den Tod zu – in Form von Tagebuchaufzeichnungen Sinn und Struktur aufzuzwingen oder auch abzuringen: der Versuch, das Jetzt (schnell, schnell, bevor es zum Schon-Vorbei wird!) nicht nur zu dokumentieren, sondern im wahrsten Sinne des Wortes festzuhalten, zu verewigen, ihm lauter Denkmäler zu setzen, und sei es in einem kurzatmigem Medium mit Langzeitgedächtnis wie dem Internet. Verweile doch, du bist so schön und meine Pizza gerade so lecker! Oder, falls Sie‘s lieber mit den Denkern als mit den Dichtern halten: Follow me ergo sum.
Jedes Tweet ist – ebenfalls im Wortsinn – ein Lebenszeichen, einMachtwort Aufschrei jämmerliches Piepsen gegen die Vergänglichkeit: „Hallo, ich bin‘s! Mich gibt es, ja wirklich! Dass es mich gibt, verdient Beachtung! Hallooooo ... hört mich denn niemand?!?!?!?“ Es ist Selbstvergewisserung und zugleich Signal an andere, an Bekannte und Unbekannte, Freund und Follower. Diesen Willen zum Sinn, diesen Drang, all die kleinen Augenblicke ja nicht unbemerkt verstreichen zu lassen, finde ich so traurig wie tröstlich: traurig, weil sie doch nur uns selber etwas bedeuten, und tröstlich, weil sie uns so viel bedeuten.
Ach, ist der Himmel heute wieder herrlich blau! Ob sich die Vögel vor meinem Fenster wohl auch den Kopf zerbrechen, warum sie zwitschern?
Bisweilen erschreckt mich mein eigenes Mitteilungsbedürfnis. Wie komme ich dazu, Ihnen (ja, Sie da, die Sie eigentlich nur wissen wollten, wie man in zwei Monaten einen Krimi schreibt, und sich dann festgelesen haben – herzlich willkommen in unserem kleinen virtuellen Büro!) und Ihnen, der Sie regelmäßig mal vorbeischauen, weil Sie den Praktikanten süß finden, Details aus meinem wenig spektakulären Privat- und Berufsleben anvertrauen zu wollen? Bilde ich mir allen Ernstes ein, Sie interessiert, was ich von Kaizen, Atomkraft, geschweige denn vom Web 2.0 halte, was mir auf der Pasta-Party oder beim Lauftraining durch den Kopf geht und ob ich mich von der Schweinegrippen-Panik anstecken lasse?
Was in einem Blog noch verbrämt als mehr oder weniger tiefgründige Betrachtungen über den Alltag des durchschnittlichen Internet-Nutzers im beginnenden 21. Jahrhundert daherkommt, darf sich bei Twitter hemmungslos austoben: der Impuls, die Mit- oder gar die Nachwelt an jenen Momenten teilhaben zu lassen, deren flüchtige Banalität uns, während wir sie erleben, in ihrer unerträglichen Bedeutungsfülle schier das Herz zerlegt.
Tweets sind die primitivste Form jener uralten Tradition, dem Leben – dieser unaufhaltsamen, unvorhersehbaren Bewegung auf den Tod zu – in Form von Tagebuchaufzeichnungen Sinn und Struktur aufzuzwingen oder auch abzuringen: der Versuch, das Jetzt (schnell, schnell, bevor es zum Schon-Vorbei wird!) nicht nur zu dokumentieren, sondern im wahrsten Sinne des Wortes festzuhalten, zu verewigen, ihm lauter Denkmäler zu setzen, und sei es in einem kurzatmigem Medium mit Langzeitgedächtnis wie dem Internet. Verweile doch, du bist so schön und meine Pizza gerade so lecker! Oder, falls Sie‘s lieber mit den Denkern als mit den Dichtern halten: Follow me ergo sum.
Jedes Tweet ist – ebenfalls im Wortsinn – ein Lebenszeichen, ein
Ach, ist der Himmel heute wieder herrlich blau! Ob sich die Vögel vor meinem Fenster wohl auch den Kopf zerbrechen, warum sie zwitschern?
Kommunikation - Beate Brown - 3. Jun, 09:25