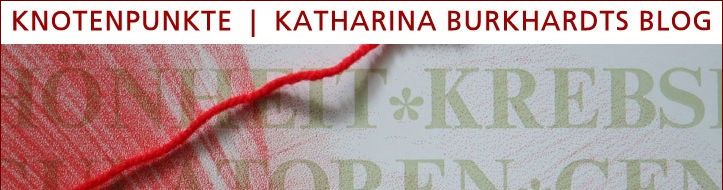Prakti rennt (II)
Sonntagmorgen im Park. Der Praktikant ist zu spät – wie immer. Ich auch – wie immer. Zehn Minuten nach der verabredeten Zeit trudeln wir beide am Treffpunkt ein. Der Praktikant wirkt nervös, fummelt ewig lange an seiner Wunderuhr rum.
„Aber laufen musst du schon noch selber“, ziehe ich ihn auf. „Das weißt du, oder?“
„Du bist ja nur neidisch“, entgegnet er und hält mir das gute Stück zur Begutachtung vor die Nase. Da hat sich Papa seine Investition in Sohnemanns Sportlerkarriere ordentlich was kosten lassen, wenn‘s schon mit der väterlichen Fürsorge eher suboptimal geklappt hat! Ob er das Gerücht kennt, dem zufolge marktführende Unternehmen in anderen Ländern bei Bewerbungsgesprächen routinemäßig die Marathon-Bestzeit abfragen?
Während wir unter Bäumen, die vergnügt im Sonnenschein vor sich hin grünen, am Kanal entlang laufen, während es überall um uns herum so munter zwitschert wie sonst nur auf Twitter, erinnere ich mich all der Tage im Dezember und Januar, an denen der Morgen noch nicht einmal graute, sondern sich pechschwarz und zappenduster als ein solcher ausgab; der tückisch vereisten Bürgersteige; der tauben Finger, die kaum noch den Wohnungsschlüssel im Schloss umzudrehen vermochten; und jenes unvergesslichen dreistündigen Trainingslaufs im Schneematsch und einsetzenden Dauerregen, bei dem ich mit einer aufgeschürften Handfläche und einer „unbrauchbar gemachten“ S-Bahn-Monatskarte noch glimpflich davonkam – aber eben auch der verzauberten Schneelandschaften, in denen ich als allererste meine Fußabdrücke hinterließ. Warum tut man sich das immer wieder an? Diese Frage scheint uns Läufer freilich weit weniger zu beschäftigen als die Menschen um uns herum. Denn wir wissen, warum, oder ahnen es zumindest
Ich unterhalte den Praktikanten mit Laufstories, die ich selber nur vom Hörensagen kenne: vom Bangkok-Marathon, wo der Startschuss mitten in der Nacht fällt, weil tagsüber die Luft zu schlecht wäre; von Wettkämpfen, bei denen die 42 Kilometer in stillgelegten Bergwerken, in Straßentunneln oder Gefängnishöfen abgespult werden. Ich erzähle von der Zuschauerin, die ihrem Liebsten bei Kilometer 1 zurief: „Geht schon noch!“; von den Witzbolden neulich in Rom, die in jeder Unterführung „Seven Nation Army“ anstimmten; von den tanzenden Luftballons der Pacemaker und der guten Stimmung, als befänden wir uns alle zusammen auf einem Karnevalsumzug – ganz schön aufgekratzt, aber super gelaunt –; und ich beichte ihm, wie ich beim Zieleinlauf am Kolosseum mit Tränen kämpfte, die mir in die Augen schießen wollten. Er lacht mit mir über die Läufer, die sich am Marathontag anrufen lassen, nur damit sie ihr schweißnasses Handy aus der Tasche fummeln und japsen können: „Ja hallo, ich bin hier gerade bei Kilometer 27. Und was machst Du heute so?“ Von denen, die sich vor dem Start zwischen Gepäckabgabe und Dixieklo noch schnell eine Kippe anzünden, erzähle ich besser nichts – das würde ihn nur auf dumme Gedanken bringen.
Stattdessen versuche ich ihm zu erklären, warum ich persönlich am liebsten ganz ohne technischen Schnickschnack, sogar ohne MP3-Player auf die Strecke gehe. Das Laufen erledigen die Beine, Herz und Lunge die Sauerstoffversorgung, für alles andere ist mein Kopf zuständig.
„Bei meinem allerersten Halbmarathon musste ich aus dem hintersten Block starten“, sage ich. „Um mich herum waren alle furchtbar aufgeregt damit beschäftigt, sich gegenseitig ihre Herzfrequenzen vorzulesen. Ein Jahr später stand ich in Startblock B, gleich hinter der Elite“ – ein bisschen Stolz darf sein, oder? – „und die alten Hasen haben sich über tausend Dinge, nur nicht über ihre Pulsuhren.“
Meine Nase juckt ein wenig vom Heuschnupfen, aber sonst geht’s mir gut. Der Praktikant dagegen sagt immer weniger. Ich beschließe, die letzte Schleife etwas abzukürzen, und bald sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen.
„Und? Wie fühlst du dich?“ frage ich, während ich dem Praktikanten ein paar sanfte Dehnübungen vormache.
„Mein Puls ist bei 186.“
„Das war nicht meine Frage. Wie fühlst du dich?“
Der Praktikant zuckt die Schultern. „Geht gleich wieder.“
„Sag mal, magst du zum Frühstücken mit zu uns kommen?“ Eine ganz spontane Idee – ehrlich.
„Ich hab nichts zum Umziehen dabei.“
„Macht nichts“, sage ich. „Mein Mann hat gefühlte 32 Paar Jeans, der leiht dir bestimmt gerne eins. Und wenn du statt deinem Piraten-Sweatshirt mit einem Tour-T-Shirt von einer Punkband deiner Wahl vorlieb nimmst, geht auch das klar.“
„Aber keine Moralpredigten über vegetarische Ernährung oder Ökostrom, okay? Es ist Wochenende, ich will einfach nur chillen.“
Wofür hält er mich? „Versprochen“, schwöre ich. „Komm, wir holen erst noch Brötchen.“
„Ihr habt doch Nutella da?“ fragt der Praktikant argwöhnisch.
(Nein, bloß Samba, aber das verrate ich ihm lieber nicht.)
„Aber laufen musst du schon noch selber“, ziehe ich ihn auf. „Das weißt du, oder?“
„Du bist ja nur neidisch“, entgegnet er und hält mir das gute Stück zur Begutachtung vor die Nase. Da hat sich Papa seine Investition in Sohnemanns Sportlerkarriere ordentlich was kosten lassen, wenn‘s schon mit der väterlichen Fürsorge eher suboptimal geklappt hat! Ob er das Gerücht kennt, dem zufolge marktführende Unternehmen in anderen Ländern bei Bewerbungsgesprächen routinemäßig die Marathon-Bestzeit abfragen?
Während wir unter Bäumen, die vergnügt im Sonnenschein vor sich hin grünen, am Kanal entlang laufen, während es überall um uns herum so munter zwitschert wie sonst nur auf Twitter, erinnere ich mich all der Tage im Dezember und Januar, an denen der Morgen noch nicht einmal graute, sondern sich pechschwarz und zappenduster als ein solcher ausgab; der tückisch vereisten Bürgersteige; der tauben Finger, die kaum noch den Wohnungsschlüssel im Schloss umzudrehen vermochten; und jenes unvergesslichen dreistündigen Trainingslaufs im Schneematsch und einsetzenden Dauerregen, bei dem ich mit einer aufgeschürften Handfläche und einer „unbrauchbar gemachten“ S-Bahn-Monatskarte noch glimpflich davonkam – aber eben auch der verzauberten Schneelandschaften, in denen ich als allererste meine Fußabdrücke hinterließ. Warum tut man sich das immer wieder an? Diese Frage scheint uns Läufer freilich weit weniger zu beschäftigen als die Menschen um uns herum. Denn wir wissen, warum, oder ahnen es zumindest
Ich unterhalte den Praktikanten mit Laufstories, die ich selber nur vom Hörensagen kenne: vom Bangkok-Marathon, wo der Startschuss mitten in der Nacht fällt, weil tagsüber die Luft zu schlecht wäre; von Wettkämpfen, bei denen die 42 Kilometer in stillgelegten Bergwerken, in Straßentunneln oder Gefängnishöfen abgespult werden. Ich erzähle von der Zuschauerin, die ihrem Liebsten bei Kilometer 1 zurief: „Geht schon noch!“; von den Witzbolden neulich in Rom, die in jeder Unterführung „Seven Nation Army“ anstimmten; von den tanzenden Luftballons der Pacemaker und der guten Stimmung, als befänden wir uns alle zusammen auf einem Karnevalsumzug – ganz schön aufgekratzt, aber super gelaunt –; und ich beichte ihm, wie ich beim Zieleinlauf am Kolosseum mit Tränen kämpfte, die mir in die Augen schießen wollten. Er lacht mit mir über die Läufer, die sich am Marathontag anrufen lassen, nur damit sie ihr schweißnasses Handy aus der Tasche fummeln und japsen können: „Ja hallo, ich bin hier gerade bei Kilometer 27. Und was machst Du heute so?“ Von denen, die sich vor dem Start zwischen Gepäckabgabe und Dixieklo noch schnell eine Kippe anzünden, erzähle ich besser nichts – das würde ihn nur auf dumme Gedanken bringen.
Stattdessen versuche ich ihm zu erklären, warum ich persönlich am liebsten ganz ohne technischen Schnickschnack, sogar ohne MP3-Player auf die Strecke gehe. Das Laufen erledigen die Beine, Herz und Lunge die Sauerstoffversorgung, für alles andere ist mein Kopf zuständig.
„Bei meinem allerersten Halbmarathon musste ich aus dem hintersten Block starten“, sage ich. „Um mich herum waren alle furchtbar aufgeregt damit beschäftigt, sich gegenseitig ihre Herzfrequenzen vorzulesen. Ein Jahr später stand ich in Startblock B, gleich hinter der Elite“ – ein bisschen Stolz darf sein, oder? – „und die alten Hasen haben sich über tausend Dinge, nur nicht über ihre Pulsuhren.“
Meine Nase juckt ein wenig vom Heuschnupfen, aber sonst geht’s mir gut. Der Praktikant dagegen sagt immer weniger. Ich beschließe, die letzte Schleife etwas abzukürzen, und bald sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen.
„Und? Wie fühlst du dich?“ frage ich, während ich dem Praktikanten ein paar sanfte Dehnübungen vormache.
„Mein Puls ist bei 186.“
„Das war nicht meine Frage. Wie fühlst du dich?“
Der Praktikant zuckt die Schultern. „Geht gleich wieder.“
„Sag mal, magst du zum Frühstücken mit zu uns kommen?“ Eine ganz spontane Idee – ehrlich.
„Ich hab nichts zum Umziehen dabei.“
„Macht nichts“, sage ich. „Mein Mann hat gefühlte 32 Paar Jeans, der leiht dir bestimmt gerne eins. Und wenn du statt deinem Piraten-Sweatshirt mit einem Tour-T-Shirt von einer Punkband deiner Wahl vorlieb nimmst, geht auch das klar.“
„Aber keine Moralpredigten über vegetarische Ernährung oder Ökostrom, okay? Es ist Wochenende, ich will einfach nur chillen.“
Wofür hält er mich? „Versprochen“, schwöre ich. „Komm, wir holen erst noch Brötchen.“
„Ihr habt doch Nutella da?“ fragt der Praktikant argwöhnisch.
(Nein, bloß Samba, aber das verrate ich ihm lieber nicht.)
Feierabend - Beate Brown - 20. Apr, 09:15